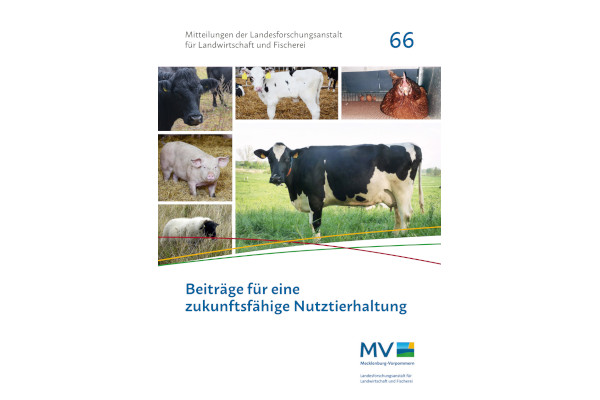Auswirkungen einer verringerten Melkfrequenz p.p. auf Laktationsverlauf, Stoffwechselgesundheit und Fruchtbarkeit
Die Züchtung der Milchkühe auf hohe Leistungen führt i.d.R. auch und insbesondere bei Kühen ab der zweiten Kalbung zu sehr hohen Einstiegsleistungen. Bei nicht adäquat entwickeltem Haltungs- und Fütterungsmanagement, kann dies in den ersten Laktationstagen und –wochen zu einer besonders heftigen Ausprägung des Phänomens der negativen Energiebilanz zwischen Energieverzehr und Energieeigenverbrauch bzw. Energieabgabe über die Milch führen.
Managementmaßnahmen wie die Erhöhung der Melkfrequenz sind darauf ausgerichtet, das Milchbildungsvermögen des Euters maximal und nachhaltig für die aktuelle Laktation zu entwickeln. Nach Stelwagen (2001) sowie Dahl u. a. (2004) erhöht sich die Milchleistung insgesamt und auch zum Zeitpunkt der höchsten Milchleistung (Milch peak). Im Umkehrschluss könnte eine gegenüber dem Standard verringerte Melkfrequenz, beispielsweise von zweimal auf einmal oder dreimal auf zweimal dazu beitragen, dass das Milchbildungsvermögen des Euters vorübergehend und nicht nachhaltig verringert wird. Bei gleichbleibender Futteraufnahme trüge dies zu einer Entlastung des Stoffwechsels bei, was gerade in Herden mit extremen Problemen vorübergehend genutzt werden kann.
Nach positiven Erfahrungen wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesem Thema wurde durch das Institut für Tierproduktion der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei ein Praxisversuch initiiert in dem nur während der Kolostralmilchperiode die Melkfrequenz von normal dreimal täglich auf zweimal täglich reduziert wurde. Die Auswirkungen auf die Laktationsleistung, Parameter der Stoffwechselgesundheit und die Fruchtbarkeit wurden untersucht.
Dokumente
| Verfasser | Dr. Bernd Losand |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 20.05.2014 |
| Telefon | 038208 / 630-314 |
| b.losand@lfa.mvnet.de |